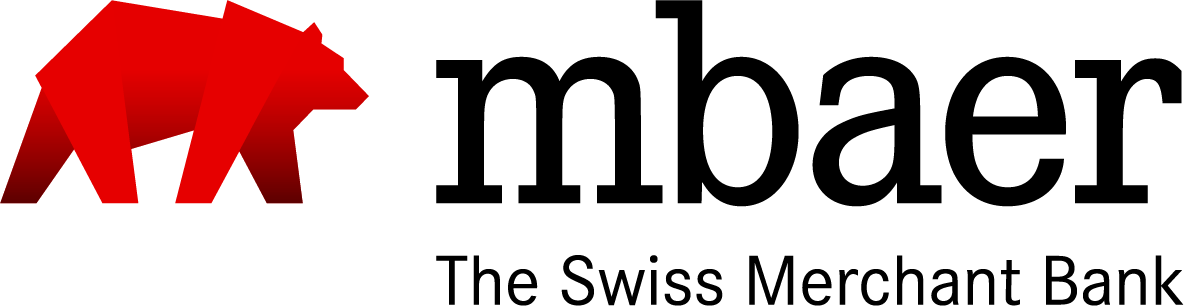In den letzten Jahren verzeichneten Private-Equity-Buyout-Fonds und private Kreditvehikel ein beispielloses Wachstum bei der Mittelbeschaffung und den Transaktionsaktivitäten. Eine drastische Veränderung des makroökonomischen Umfelds hat jedoch zu erheblichen Herausforderungen geführt. Höhere Zinssätze und ein schleppender IPO-Markt haben es für Buyout-Unternehmen schwieriger gemacht, Investitionen zu veräussern und Geld an Investoren zurückzuzahlen, was wiederum die Beschaffung neuer Finanzmittel erschwert, da Pensionsfonds und andere Kapitalgeber mit knapperen Kapitalressourcen und attraktiveren Alternativen konfrontiert sind. Gleichzeitig sind viele institutionelle Portfolios nach dem Markteinbruch von 2022 übermässig in illiquide private Vermögenswerte investiert, was eine Neubewertung der Liquiditäts- und Renditeerwartungen erforderlich macht.

Private Märkte stehen vor einer neuen Realität
Nach einem Jahrzehnt billiger Kredite hat der rasante Anstieg der Zinsen seit 2022 die Rahmenbedingungen für fremdfinanzierte private Investitionen grundlegend verändert. Bei Private-Equity-Buyouts sind die Kosten für die Fremdfinanzierung in die Höhe geschnellt, was das Transaktionsvolumen und die internen Renditen direkt einschränkt. Buyout-Fonds können nicht mehr auf niedrige Kreditkosten zählen, um ihre Eigenkapitalgewinne zu steigern, und viele hoch verschuldete Portfoliounternehmen haben nun Schwierigkeiten mit dem Schuldendienst. Dieses Umfeld mit höheren Zinsen und langsameren Wachstumsraten hat die Wirksamkeit des „Financial Engineering” stark eingeschränkt: Die jüngsten PE-Renditen stammten aus der Ausweitung der Bewertungsmultiplikatoren, aber dieser Rückenwind verschwindet nun. Manager sind gezwungen, sich stärker auf echtes Umsatzwachstum und operative Verbesserungen zu verlassen, um die Performance zu steigern. Die teureren Kredite tragen ebenfalls zur zunehmenden Notlage bei. Tatsächlich erreichte die Zahl der durch Private Equity finanzierten Insolvenzen im Jahr 2024 einen historischen Höchststand, was die Belastung durch übermässig fremdfinanzierte Transaktionen unterstreicht.
Für private Kreditgeber versprachen steigende Leitzinsen zunächst höhere Renditen, aber sie bergen auch neue Risiken. Viele Direktkreditfonds florierten, als die Zinsen nahe Null lagen, doch das heutige Hochzinsumfeld stellt die Rückzahlungsfähigkeit der Kreditnehmer auf die Probe. Führende Investoren haben davor gewarnt, dass der intensive Wettbewerb bei privaten Krediten zu einer Verringerung der Spreads geführt hat, obwohl in einer Rezession Ausfallrisiken drohen. So warnte beispielsweise die singapurische GIC, dass der rasante Aufstieg privater Kredite mit begrenzten historischen Ausfallerfahrungen und geringeren Prämien einhergeht. Kurz gesagt: Während private Kredite boomten, als sich die Banken zurückzogen, könnten höhere Kreditkosten Schwachstellen in den Kreditvergabestandards und der Widerstandsfähigkeit der Kreditnehmer offenbaren.
Bewertungen und verzögerte Abschreibungen
Ein charakteristisches Problem der privaten Märkte ist die Verzögerung bei Bewertungsabschlägen im Vergleich zu den öffentlichen Märkten. Private-Equity-Portfolios wurden während des Ausverkaufs an den öffentlichen Märkten im Jahr 2022 nicht so schnell nach unten korrigiert, sodass viele Vermögenswerte auf dem Papier potenziell überbewertet waren. Da diese Bestände nun schliesslich neu bewertet werden oder Schwierigkeiten haben, wieder ihre früheren Bewertungen zu erreichen, müssen Anleger mit gedämpften Renditen rechnen. Tatsächlich hat ein erheblicher Teil der privaten Vermögenswerte aus dem letzten Zyklus kaum oder gar keine Wertsteigerung erfahren: Mehr als ein Drittel der seit sechs Jahren oder länger gehaltenen PE-Vermögenswerte sind heute genauso viel oder weniger wert als ihr Kaufpreis. Diese stagnierenden oder sinkenden Werte haben die Leistungskennzahlen der gesamten Branche nach unten gezogen. Daten von PitchBook zeigen, dass die annualisierte IRR von Private Equity im Jahr bis März 2024 unter 10 % gefallen ist – ein deutlicher Rückgang gegenüber den jährlichen Renditen von ~25 %, die die Branche früher anstrebte.
Dieser Bewertungsüberhang bedeutet, dass viele Fonds ihre Vermögenswerte nur langsam abschreiben, was das Risiko weiterer „Aufholkorrekturen” mit sich bringt. Die „NAV-Veraltung” trug auch zum sogenannten Nenner-Effekt im Jahr 2022 bei, da private Beteiligungen ihren Wert zu halten schienen, während öffentliche Aktienkurse sanken. Die anschliessende Erholung der öffentlichen Märkte im Jahr 2023 liess die privaten Märkte dann zurückfallen. Bemerkenswert ist, dass es 2023 zu einer dramatischen Performance-Divergenz kam: Private-Equity-Portfolios erreichten kaum die Gewinnschwelle (Rendite von etwa 0,8 %), während der S&P 500 um etwa 17,5 % zulegte. Diese Umkehr – nach den unrealistisch glatten PE-Renditen des Jahres 2022 – deutet darauf hin, dass die privaten Bewertungen nun wieder auf ein realistisches Niveau zurückkehren und dabei hinter den öffentlichen Märkten zurückbleiben. Diese Underperformance und Bewertungsrückstände werfen für Anleger schwierige Fragen hinsichtlich des tatsächlichen risikobereinigten Werts von Private Equity nach Abzug von Gebühren und Illiquidität auf.
Liquiditätsengpässe und Recycling-Risiken
Die Liquidität bleibt der zentrale Schwachpunkt der privaten Märkte. Nach dem Deal-Boom der Jahre 2020–2021 sehen sich Anleger nun mit einer ganz anderen Realität konfrontiert: Ausschüttungen sind rar, Kapitalabrufe gehen weiter und ein riesiger Rückstau an unverkauften Vermögenswerten verstopft die Portfolios. PitchBook berichtet, dass das Verhältnis von Investitionen zu Exits im Jahr 2025 auf etwa 3,1 zu 1 gestiegen ist, die grösste Differenz seit mehr als einem Jahrzehnt. Das bedeutet, dass für jeden Dollar Exit-Wert, der an die Anleger zurückfliesst, immer noch mehr als drei Dollar neues Kapital investiert werden. Ein klares Zeichen dafür, dass die Liquidität nicht Schritt hält.
Die Zahlen unterstreichen die Belastung. Ernst & Young schätzt, dass Private-Equity-Firmen bis Mitte 2025 rund 30'000 Portfoliounternehmen mit einem Wert von etwa 3 Billionen US-Dollar halten werden und dass mehr als ein Drittel dieser Beteiligungen seit sechs Jahren oder länger gehalten werden. Angesichts der begrenzten Exit-Möglichkeiten sind viele General Partner sogar bereit, Bewertungsabschläge von 5 bis 10 % in Kauf zu nehmen, nur um Liquidität zu erzielen. Zwar erholten sich die weltweiten Exits Anfang 2025 etwas und erreichten im ersten Quartal 302 Milliarden US-Dollar, was laut HarbourVest das stärkste erste Quartal seit Ende 2021 war, doch ist dies nur ein Bruchteil der 4 Billionen US-Dollar an Buyout-Wert, die nach wie vor gebunden sind.
Um diese Lücke zu schliessen, haben sich die Manager stark auf Fortführungsfonds und von GP-geführte Sekundärtransaktionen gestützt, die 2024 über 40 % des Transaktionsvolumens auf dem Sekundärmarkt ausmachten. Diese Vehikel bieten bestehenden Investoren optionale Liquidität, zeigen aber auch, wie schwierig traditionelle Börsengänge und Unternehmensverkäufe geworden sind. Auf der Anlegerseite haben einige Kommanditisten drastischere Massnahmen ergriffen: So hat beispielsweise die Stiftung der Yale University im Jahr 2025 fast 3 Milliarden US-Dollar an Private-Equity-Beteiligungen verkauft, um Bargeld zu beschaffen, selbst wenn dies mit Abschlägen verbunden war. Solche hochkarätigen Sekundärverkäufe zeigen, dass das Illiquiditätsrisiko von einem theoretischen Problem zu einer drängenden Realität geworden ist.
In jüngerer Zeit ist die Private-Equity-Branche noch einen Schritt weiter gegangen und nutzt Evergreen- und Semi-Liquid-Strukturen nicht nur, um den Zugang zu erweitern, sondern auch als Mechanismus, um schwer zu veräussernde Investitionen zu recyceln. Da die traditionellen Ausstiegsmöglichkeiten nach wie vor eingeschränkt sind, haben Sponsoren alternde oder unterdurchschnittlich performende Portfolio -Unternehmen in neuere Vehikel integriert, die sie verwalten, und dabei oft neues Kapital von Vermögensverwaltungskunden beschafft. Banken haben diese Produkte eifrig als exklusive Gelegenheiten für vermögende Anleger vermarktet, aber Aufsichtsbehörden und Brancheninsider warnen, dass die Realität prekärer ist. Evergreen-Fonds versprechen von Natur aus regelmässige Rücknahmen gegen Vermögenswerte, die grundsätzlich illiquide sind, und es besteht die Gefahr, dass Private-Banking-Kunden zu marginalen Käufern am Ende des Zyklus werden und damit effektiv die Ausstiegsliquidität für Profis bereitstellen, die ihre Risiken reduzieren wollen. Wie ein Gründer warnte, laufen Privatanleger Gefahr, bei solchen Transfers „mit den schlechtesten Vermögenswerten belastet“ zu werden. Was als Demokratisierung des Zugangs präsentiert wird, könnte in der Praxis dazu führen, dass vermögende Kunden die unattraktivsten Teile des privaten Marktzyklus halten.
Boom bei privaten Krediten und aufkommende Risiken
Private Kredite verdienen besondere Aufmerksamkeit, da sie in diesem neuen Umfeld sowohl Chancen als auch Risiken bergen. Nachdem sich die Banken aus bestimmten Kreditgeschäften zurückgezogen hatten (nach den Regulierungen von 2008 und während COVID), sprangen private Kreditfonds in die Bresche und sammelten sowohl von Institutionen als auch von Privatpersonen riesige Summen ein. Insbesondere vermögende Privatanleger in den USA haben in Rekordhöhe in private Kredite investiert – allein in der ersten Hälfte des Jahres 2025 waren es rund 48 Milliarden US-Dollar, bereits mehr als der Gesamtbetrag für das gesamte Jahr 2023. Mit diesen Zuflüssen sind private Kredite auf dem besten Weg, den bisherigen Höchststand von 83 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2024 zu übertreffen. Auch in Europa haben sich die Vermögenswerte in offenen „Evergreen”-Private-Debt-Fonds bis Mitte 2025 gegenüber dem Vorjahr auf 24 Milliarden Euro verdoppelt. Die Zuflüsse von vermögenden und massenreichen Anlegern sind so wichtig geworden, dass Analysten von Moody's einzelne Anleger als „eine der grössten neuen Wachstumsgrenzen” für die Branche bezeichnen. Kurz gesagt: Auch wenn sich einige grosse Institutionen zurückziehen, hat privater Kredit neue Nachfrage von renditehungrigen vermögenden Kunden, Unternehmensentwicklungsgesellschaften und anderen nicht-traditionellen Quellen gefunden.
Der Boom bei privaten Krediten birgt jedoch auch Risiken. Zum einen kann der Kapitalzufluss zu schwächeren Kreditvergabestandards und niedrigeren Renditen führen. Wie bereits erwähnt, haben Top-Investoren wie GIC Alarm geschlagen, dass private Kreditgeschäfte zu Spreads abgeschlossen werden, die das Risiko möglicherweise nicht angemessen kompensieren. Der Markt ist so schnell gewachsen (seine Grösse hat sich in vier Jahren etwa verdoppelt), dass ein signifikanter wirtschaftlicher Abschwung noch nicht wirklich getestet hat, wie sich diese meist mittelständischen Kreditnehmer behaupten können. Im Gegensatz zu breit syndizierten Krediten oder Anleihen sind viele private Kredite illiquide und werden nur in geringem Umfang gehandelt, sodass sich die Neubewertung des Risikos verzögern kann. Die Ausfallraten bei privaten Krediten könnten von ihrem historisch niedrigen Niveau aus steigen, wenn höhere Zinskosten und eine sich abkühlende Konjunktur den Cashflow der Kreditnehmer belasten. Wenn viele Investoren in private Kredite neu in diesem Bereich sind, sind sie möglicherweise weniger gut auf potenzielle Liquiditätsengpässe oder Abschreibungen vorbereitet, sollte sich die Kreditperformance verschlechtern. Die grösste Sorge ist, dass private Kredite, die oft als sicherere, besicherte Anlageklasse gepriesen werden, in ihrer derzeitigen Grössenordnung noch keinen vollständigen Ausfallzyklus durchlaufen haben. Eine Zunahme der Unternehmensnotlagen könnte offenbaren, wie viel von diesem 1-Billionen-Dollar-Markt auf Perfektion ausgerichtet war.
Überdenken der Illiquiditätsprämie
Eine zunehmend diskutierte Frage ist, ob die viel gepriesene Outperformance von Private Equity gegenüber öffentlichen Aktien in diesem sich wandelnden Umfeld Bestand haben wird. Aktuelle Daten deuten darauf hin, dass dies nicht der Fall ist. Wie bereits erwähnt, übertrafen die breiten öffentlichen Aktienindizes im Jahr 2023 die durchschnittliche Performance von Private-Equity-Fonds deutlich (17 % gegenüber ~1 %). Dies geschah nach einem ungewöhnlichen Jahr 2022, in dem die Renditen von Private Equity trotz fallender öffentlicher Märkte positiv blieben (nach einer Schätzung +21 %), was im Wesentlichen eine Illusion war, die durch Bewertungsrückstände entstanden war. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, weist Private Equity immer noch eine Prämie gegenüber öffentlichen Aktien auf, aber diese Prämie verringert sich. Unter Berücksichtigung von Gebühren, Illiquidität und Überlebensverzerrung sind die risikobereinigten Renditen von Private Equity in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten. Die Zahlen von PitchBook zeigen, dass die IRRs für PE zuletzt unter 10 % lagen. Angesichts der Tatsache, dass US-Schatzwechsel zuletzt eine Rendite von rund 5 % erzielten, bedeutet dies, dass die Überrendite für die Bindung von Kapital und das Eingehen von Hebelrisiken geringer ist als zuvor.
Institutionelle Anleger und erfahrene Family Offices fragen sich zunehmend, ob die „Illiquiditätsprämie” ausreichend ist. Die starke Erholung des S&P 500 und die Verfügbarkeit von Renditen von 5–6 % bei hochrangigen Anleihen bieten praktikable Alternativen zu neuen Private-Equity-Fonds. Darüber hinaus sind die Renditen von Private Equity in der Regel stabil, bis sie es plötzlich nicht mehr sind. Dies kann in volatilen Zeiten ein falsches Gefühl der Sicherheit vermitteln, das später zu Enttäuschungen führt. Einige Anleger passen daher ihre Erwartungen an und betrachten Private Equity eher als langfristige Diversifizierungsmöglichkeit und aktives Managementinstrument denn als garantierten Alpha-Generator gegenüber öffentlichen Benchmarks. Auch bei privaten Krediten wird die Performance im Vergleich zu liquiden Hochzinsanleihen oder Leveraged Loans genau beobachtet werden. Wenn Private Credit weiterhin mittlere bis hohe einstellige Renditen bei geringer Volatilität erzielen kann, wird es sich rechtfertigen. Wenn jedoch Ausfälle die Renditen schmälern, könnten Anleger es in Frage stellen, hohe Gebühren für etwas zu zahlen, das mit öffentlichen Schuldtiteln oder direkten Anleihenportfolios repliziert werden könnte.
Spät im Zyklus
Private Equity und Private Credit treten in eine Phase der Ernüchterung ein. Die Annahmen, die das letzte Jahrzehnt geprägt haben (günstige Fremdkapitalaufnahme, einfache Exits, ständig steigende Bewertungen und eine hohe institutionelle Nachfrage), sind nicht mehr sicher. Steigende Zinsen, verzögerte Abschreibungen, eingeschränkte Liquidität und Allokationsmüdigkeit haben die Performance gegenüber den öffentlichen Märkten bereits beeinträchtigt. Für viele erfahrene Allokatoren erscheint die einst versprochene Illiquiditätsprämie nun geringer, insbesondere vor dem Hintergrund eines wiedererstarkten S&P 500 und hoher einstelliger Renditen bei liquiden festverzinslichen Wertpapieren.
Die beunruhigendste Entwicklung ist die Verlagerung des Vertriebs hin zu Vermögensverwaltungskunden. Durch die Umwandlung privater Fonds in semi-liquide Vehikel und Evergreen-Strukturen bieten Banken Zugang genau zu dem Zeitpunkt, zu dem institutionelle Anleger Sekundärmarktanteile verkaufen, ihre Engagements zurückfahren oder Liquidität verlangen. Regulierungsbehörden und Marktkommentatoren warnen davor, dass diese Demokratisierung das Risiko birgt, private Kunden zu marginalen Käufern am Ende des Zyklus zu machen. Diejenigen, die überdehnte oder illiquide Vermögenswerte halten, wenn die Profis bereits begonnen haben, sich zurückzuziehen.
Das bedeutet nicht, dass private Märkte irrelevant sind. Sie bleiben wichtige Quellen für Kapitalbildung und potenziellen langfristigen Wert. Aber Investoren, ob Institutionen oder vermögende Privatpersonen, müssen sie mit einem kritischeren Blick betrachten. Die Auswahl der Manager, die Transparenz der Bewertungen, die Angleichung der Anreize und die Liquiditätsplanung sind von grösster Bedeutung. Vor allem müssen Investoren sich der Erzählung widersetzen, dass Private Equity oder Private Credit ein One-Way-Ticket zu überdurchschnittlichen Renditen sind. Im heutigen Umfeld muss die Illiquiditätsprämie verdient und darf nicht vorausgesetzt werden, und der Zugang garantiert keinen Vorteil.